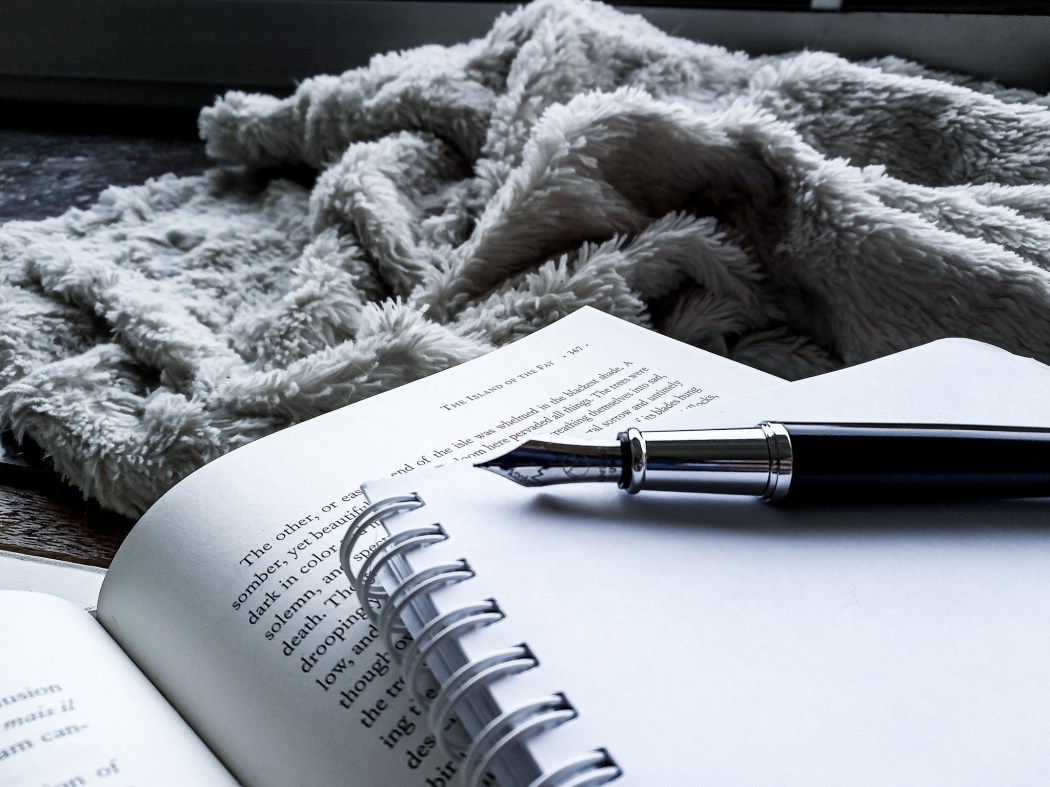
Janet Cooke ist mit ihrer erfundenen Reportage „Jimmy’s World“ in die Geschichte des modernen Journalismus eingegangen – allerdings nicht auf positive Weise. Ihr Fall ist zu einem Beispiel geworden, wie Journalisten nicht arbeiten sollten.
Was ist eine Reportage?
Die Reportage hat ihren Ursprung in den traditionellen Reiseberichten sowie Augenzeugenberichten. Beide Schreibformen dienten dazu, dem Leser durch detaillierte Darstellungen unbekannte Orte, Menschen, Lebens- und Denkweisen näherzubringen. Sie waren Brücken zwischen den Lesern und den Ereignissen. Zu den frühen Inspirationen gehören Emile Zola, Honoré Balzac, Heinrich Heine und Theodor Fontane. Die Reportage wurde am Anfang ihrer Entstehung noch kritisch betrachtet. Für die Bürger waren Reporter weder Schriftsteller noch Politiker, sie wurden als talent- und eigenschaftslos beschimpft. Immer wieder wurde die Reportage mit dem Roman verglichen: einerseits wurde behauptet, dass die Reportage von der Dichtung abgeschaut hätte, andererseits wurde sie verteidigt und gesagt, der Roman könne von der Reportage lernen. Auch Schriftsteller Alfred Döblin sieht ein gewisses Vorbild der Reportage im Roman und lobt, dass sie die Wirklichkeit dichterisch darstellen wolle. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Reportage in Deutschland und Frankreich als Kunst und Literatur anerkannt und ernst genommen.
Mittlerweile hat sich die Reportage jedoch als Gattung etabliert. Der deutsche Kommunikationswissenschaftler und Soziologe Siegfried Weischenberg spricht sogar von der „Königsform des Journalismus“. In der Reportage geht es um Einzelfälle und -schicksale, welche konkret dargestellt werden. Gleichzeitig sei es allerdings auch Aufgabe des Reporters, diesen Einzelfall in größere Zusammenhänge einzubetten, erst dadurch erhalte die Reportage ihren typischen Charakter, so der Philosoph und Literaturwissenschaftler Georg Lukács. Die Themen umfassen Bereiche wie Wirtschaft, Kultur, Politik, Sport, Soziales, Geschichte und Justiz – die Möglichkeiten für Reportagen sind unendlich. Oftmals spielen auch die verschiedenen Sinne – sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken – eine große Rolle: Eine Reportage kann besonders lebhaft gestaltet werden, wenn der Reporter Sinneseindrücke verarbeitet. Er kann beispielsweise die Gerüche und Geräusche beschreiben, die er von den Marktständen wahrnimmt, wenn er über einen typischen Arbeitstag eines Fischverkäufers schreibt.
Die Reportage zeichnet sich durch ‚Authentizität‘, ‚Subjektivität‘ und ‚Individualität‘ aus – also ein starker Kontrast zu den objektiven Nachrichten. Beobachten, schildern, erzählen – das sind die Aufgaben eines Reporters. Eine persönliche Färbung der Ereignisse ist wünschenswert, dennoch wird dem Reporter abverlangt, dass er genau so gewissenhaft und korrekt arbeitet wie seine anderen Kollegen im Journalismus. Trotz Subjektivität muss er die Tatbestände vollständig und wahrheitsgetreu wiedergeben. Es ist schwieriger für den Journalisten, die Reportage schwungvoll und mitreißend zu gestalten, ohne die Wahrheit zu verfälschen.
Eine Reportage schreiben heißt Beobachten, das bedeutet auch: „Wer nichts erlebt hat, kann keine Reportage schreiben“, so der Journalist und Medienwissenschaftler Michael Haller. Der Reporter muss hinaus aus der Redaktion und mit dabei sein, wenn etwas geschieht, er muss so viele Eindrücke einfangen wie möglich. Das ist auch die Kernidee des amerikanischen New Journalism der 1960er und 70er Jahre (Tom Wolfe, Truman Capote, Joan Didion etc.). Wer nur an seinem Schreibtisch sitzt, kann über nichts berichten.
Journalistische Fälschungen
Auch wenn Medien ihre eigene Realität konstruieren und Fakten nur gefiltert wiedergeben, lässt sich dennoch nicht abstreiten, dass diese Realität auf den gegebenen Fakten basiert. In den letzten Jahrzehnten gab es jedoch einige Fälle, in denen die Journalisten sich nicht auf existierende Fakten gestützt, sondern entweder die abzubildende Realität extrem beeinflusst oder ihre Artikel völlig frei erfunden haben.
Ein spektakuläres Beispiel für die Erfindung ganzer Geschichten ereignete sich in den 1990er Jahren in den USA. Der damals 25-jährige aufstrebende Journalist Stephen Glass erlangte durch seine fingierten Reportagen für The New Republic Ruhm. Zunächst wurde nur aufgedeckt, dass seine Story über jugendliche Hacker größtenteils erfunden war. Bei weiteren Nachforschungen entdeckte man, dass Glass noch mehr seiner insgesamt 41 Artikel für die Zeitung gefälscht hatte und dass rund die Hälfte ebendieser fingierte Angaben enthielt.
Ebenfalls in den 90ern machte der Schweizer Journalist Tom Kummer Schlagzeilen. Er interviewte für angesehene Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung und das ZEIT Magazin Prominente, unter ihnen Hollywood-Stars und Größen der Popmusik. Zumindest teilweise fanden diese Interviews wirklich statt, viele von ihnen waren aber auch frei erfunden. Oftmals hatte nie ein persönliches Treffen zwischen Kummer und den Stars stattgefunden. Dazu gehören fiktive Interviews mit Courtney Love, Jenny Mccarthy, Snoop Dogg und Pamela Anderson. Statt zu seiner Schuld zu stehen, verteidigte Kummer seine Interviews, indem er behauptete, er wolle die Realität im Journalismus völlig neu definieren und die Stars nicht als private Individuen, sondern als Repräsentanten des oberflächlichen Hollywoods darstellen. Interviews, genau wie Berichte, Reportagen, etc., beanspruchen einen Wahrheitsgehalt für sich. Fiktive Interviews müssen daher auch als solche gekennzeichnet werden, ansonsten sind sie schlichtweg erfunden und unwahr.
Der Fall Janet Cooke
Ähnliches geschah im Jahr 1980, als die Washington Post-Reporterin Janet Cooke ihre Reportage „Jimmy’s World“ veröffentlichte und ein Jahr später den Pulitzerpreis in der Kategorie Feature Writing erhielt. Zu dieser Zeit war sie keine zwei Jahre bei der Post angestellt. Dass ihre Reportage erfunden war, wurde lediglich entdeckt, nachdem man Cookes beim Pulitzer-Kommittee eingereichte Biografie mit der damals bei der Post angegebenen verglich und erhebliche Diskrepanzen festgestellt wurden. Als die junge und ambitionierte Cooke sich um die Stelle bei der Post bewarb, hatte die sich gerade durch ihre Watergate-Artikel eine enorme Reputation erarbeitet. Cooke gab in ihrer Bewerbung an, dass sie ihren Abschluss am Vassar College gemacht hätte, fließend Französisch und Spanisch spreche sowie einen Preis für ihre journalistischen Leistungen bei der Toledo Blade gewonnen hätte. Dies wurde von den verantwortlichen Mitarbeitern der Post nicht weiter überprüft, sie stellten Cooke ohne Bedenken ein.
Nach vielversprechenden Artikeln näherte sich Cooke ihrer großen Titelstory. Sie sollte über eine neue Form von Heroin berichten, welche sich in Washington D.C. ausbreitete. Sie fand zwar nicht dieses neue Heroin, dafür aber unzählige Informationen über die Drogenszene in Washington. Es waren schon einige Artikel in verschiedenen Zeitungen über Drogendealer, den Drogenhandel mit der Türkei und andere Unterthemen erschienen, deshalb musste Cookes Reportage etwas Besonderes werden: Sie erzählte Bezirksredakteur Milton Coleman von einem achtjährigen Drogenabhängigen. Cooke sollte ihn ausfindig machen, doch sie scheiterte. Stattdessen erwähnte sie zwei Wochen später einen gleichaltrigen Jungen, der abhängig war. Sie schaffte es angeblich, Kontakt zu der Mutter aufzunehmen und besuchte sie in ihrem Haus. Was dort geschah, verarbeitete Cooke in „Jimmy’s World“.
Dass all das, die angeblichen Telefonate mit der Mutter, der Besuch der Familie, der Junge Jimmy, nur erfunden waren, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand wissen. Coleman respektierte die Entscheidung, dass Jimmys Mutter angeblich um Anonymität gebeten hatte. Cooke untermauerte dies damit, dass der Freund der Mutter, Ron, sie mit einem Messer bedroht hätte. Tatsächlich wäre es den Redakteuren gestattet gewesen, Cookes Artikel auf Grund nicht genannter Quellen abzulehnen. Doch niemand stellte ihre Glaubwürdigkeit offen in Frage. Coleman sagte, dass es eine großartige Story sei und es ihm nie in den Sinn gekommen wäre, dass alles nur erfunden war.
Die Story war eine Sensation und die Leser waren aufgebracht – sie machten sich Sorgen um das Leben des Jungen, sodass eine Suche durch ganz Washington D.C. gestartet wurde. Die Post verweigerte die Herausgabe des Namens und der Adresse des Jungen, den alle Welt nun unter dem Pseudonym ‚Jimmy‘ kannte. Langsam musste Coleman erkennen, dass etwas nicht stimmen konnte. Er dachte, dass die Polizei und die Bürger den Jungen doch schon lange gefunden haben müssten. Auch Cookes Kollege Courtland Millow, der mit ihr auf der Suche nach dem Jungen war, fing an, zu zweifeln. In der Gegend, in welcher Jimmy angeblich wohnte, schien Cooke alles völlig fremd zu sein. Siebzehn Tage lang ging die Suche noch voran, doch ohne Erfolg. Dann gab man auf. Nachdem Coleman Cooke vorschlug, gemeinsam zu Jimmy zu gehen, sagte Cooke ihm, sie sei dort gewesen aber die Familie sei nach Baltimore gezogen und das Haus stehe leer.
Als „Jimmy’s World“ für den Pulitzerpreis nominiert wurde, musste Janet Cooke ihre biografische Angaben weiterleiten. Sie fügte zu ihren Fremdsprachen noch Italienisch und Portugiesisch hinzu und erhöhte die Anzahl ihrer journalistischen Preise auf sechs. Des weiteren habe sie noch ein Jahr lang an der renommierten Sorbonne studiert. Am 13. April 1981 erhielt Cooke den Pulitzerpreis, doch schon kurze Zeit später meldeten sich die Universität von Toledo sowie das Vassar College, um die von Cooke dargestellten Angaben zu korrigieren.
Green berichtet davon, dass ihre Post-Kollegen Cooke zur Rede stellten. In einem Gespräch mit Coleman gestand die Reporterin zunächst, dass sie keinen Abschluss vom Vassar College habe, da sie ihr Studium dort auf Grund emotionaler Probleme abbrach, nach Hause zurückkehrte und sich an der Universität von Toledo einschrieb. Dennoch beharrte sie darauf, vier Fremdsprachen zu sprechen und an der Sorbonne studiert zu haben, sowie auf der Tatsache, dass die Geschichte um Jimmy wahr sei. Als man ihr 24 Stunden gab, um zu beweisen, dass „Jimmy’s World“ auf wahren Begebenheiten basierte, öffnete sie sich schließlich einem Kollegen und bat darum, den Pulitzerpreis zurückgeben zu dürfen. Es folgte ein schriftliches Statement von ihr:
„Jimmy’s World“ was in essence a fabrication. I never encountered or interviewed an 8-year-old heroin addict. The September 28, 1980, article in The Washington Post was a serious misrepresentation which I deeply regret. I apologize to my newspaper, my profession, the Pulitzer board and all seekers of the truth. Today, in facing up to the truth, I have submitted my resignation. Janet Cooke.
Cooke wurde daraufhin entlassen und konnte seitdem nie wieder Fuß im Journalismus fassen.
Janet Cooke hat nicht im Sinne einer Reporterin gehandelt, hat ihren Schreibtisch für „Jimmy’s World“ nicht einmal verlassen; sie hat zwar mit Sozialarbeitern über die Kinder in der Drogenszene Washingtons gesprochen, aber Gespräche mit einer Familie haben nie stattgefunden. Über etwas, das sie nicht erlebt hat, dürfte sie also genau genommen überhaupt nicht berichten, tat dieses aber trotzdem. Sie berichtet über einen Jungen, beschreibt sein Aussehen, seine Kleidung, seine Sprache, seine selbstbewusste Art, seine Träume vom eigenen Drogenhandel, sein Wohnzimmer und die Einrichtung, seinen typischen Tag in einem Haus voller Drogenabhängiger – obwohl nichts von alldem existiert.
Nach der Aufdeckung des Skandals behauptete Cooke, es gäbe zwar Jimmy nicht, dafür aber viele andere drogenabhängige Jungen, für die er ein Repräsentant sein könne. Ähnlich wie bei Tom Kummer ist ihr Problem, dass sie ihre Darstellung nicht als Fiktion gekennzeichnet hat und die Leser somit annahmen, es handelte sich um Fakten. Autorin Elisabeth Klar betont, Journalismus bleibe an die „Darstellung dessen, was ist oder was gerade passiert, gebunden. Der Journalismus sagt uns, wie es gewesen ist, nicht wie es hätte sein können oder sollen.“
Forscher, andere Journalisten und Akademiker sind sich heute einig: Cooke hätte diese Reportage niemals verfassen und die Washington Post hätte sie niemals für den Pulitzerpreis anmelden dürfen. Mit der Konstruktion von „Jimmy’s World“ hat Janet Cooke das Vertrauen der Leser in sie selbst, aber auch in den Journalismus als Ganzes, missbraucht. Sie hat ihren eigenen Ruf ruiniert sowie den von Kollegen und ihrem Arbeitgeber, der Washington Post, nachhaltig geschädigt. Ihrer Position als Reporterin konnte sie nicht gerecht werden und es ist nachvollziehbar, dass sie auf Grund einer solchen Lüge nie wieder Fuß im Journalismus fassen konnte.

[…] Janet Cooke und der zu Unrecht erhaltene Pulitzer Preis […]
LikeLike
Schwarze Schafe gibt es eben überall – auch im Journalismus. Auch in Deutschland gab es ja immer wieder ähnliche Geschichten. Einerseits ist es schon absurd wie weit manche mit ihren Lügen kommen, andererseits kommt die Wahrheit früher oder später doch ans Licht und das beruhigt mich.
LikeLike